Die Röhren
Auftieg, Fall und Niedergang einer Legende
1900 - heute
Eine Glühlampe
Schon 1883 endeckte Thomas Alva Edison, daß in einer Glühlampe, in die eine zusätzliche Elektrode
eingebracht wird ein elektrischer Strom durch das Vakuum fließt.
Doch technisch nutzbar machte diesen Effekt erst der Engländer Sir Ian Fleming 1905.
 Der Österreicher Robert von Lieben und der Amerikaner Lee de Forrest entlockten ihr ein Jahr
später unabhängig voneinander eine Verstärkerwirkung. Lee der Forrest endeckte später (1912) auch noch
den über Jahre äußerst bedeutsamen Audioneffekt, weil mit ihm gleichzeitig
demoduliert (gleichgerichtet) und verstärkt werden kann.
Der Österreicher Robert von Lieben und der Amerikaner Lee de Forrest entlockten ihr ein Jahr
später unabhängig voneinander eine Verstärkerwirkung. Lee der Forrest endeckte später (1912) auch noch
den über Jahre äußerst bedeutsamen Audioneffekt, weil mit ihm gleichzeitig
demoduliert (gleichgerichtet) und verstärkt werden kann.
Schon in den Jahren 1910-1920 und während des ersten Weltkrieges wurden eine große Anzahl von Röhren
für die Post und das Militär hergestellt. In großer Auflage wurde z.B. die Siemens Typ A produziert.
Die Röhren waren das Wichtigste in den alten Geräten. Sie verstärkten, regelten,
richteten gleich oder verzierten einfach nur, indem man sie, vor allem in der Anfangszeit des Rundfunks,
oben auf die Geräte setzte.
Hier waren sie jedermann zugänglich, weil sie doch ab und zu ausgetauscht werden mußten.
Außerdem konnte so immer geprüft werden, ob sie auch wirklich richtig glühten.
Röhren haben im Gegensatz zu ihren neueren und moderneren Geschwistern, den Transistoren
einen elektrischen Verschleiß während des Betriebs.
Die Andauernde Emission (Aussendung) von Elektronen schafft auf Dauer halt doch ganz schön.
Da die Röhren je nach Type eine beträchtliche Größe erreichen können versuchte man schon früh mehrere
von ihnen in einen Kolben zu stecken, so wie in der nachfolgend beschriebenen
Tekade VT139. Außerdem konnten die Lizenzgebühren gesenkt werden,
da dieselbe nach Anzahl verkaufter Sockel berechnet wurde.
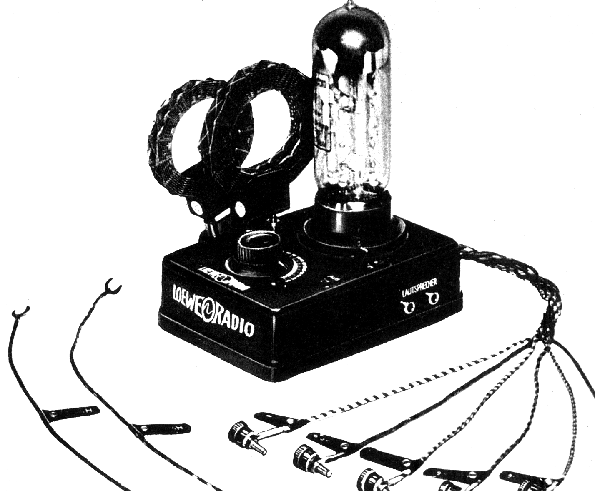 Der Berliner Radiopionier Dr. Sigmund Loewe ging sogar soweit, einen kompletten
Verstärker inklusive aller Koppelelemente unter einen großen
Kolben zu setzen.
Der erste integrierte Schaltkreis war geboren!
Der Berliner Radiopionier Dr. Sigmund Loewe ging sogar soweit, einen kompletten
Verstärker inklusive aller Koppelelemente unter einen großen
Kolben zu setzen.
Der erste integrierte Schaltkreis war geboren!
Manfred von Ardenne entwickelte hiefür den bis dahin fast unbrauchbaren
widerstandsgekoppelten Verstärker bis zur Serienreife.
Die teuren, verzerrenden Übertragertransformatoren konnten ersetzt werden.
Die frühen Röhrensysteme waren allesamt Trioden, d.h. Röhren mit drei Elektroden
(Polen). Erst ab ca. 1928 begannen sich die
ersten Mehrelektrodenröhren, die Tetroden und Pentoden zu verbreiten,
da sie besser für die Hochfrequenzverstärkung geeingnet sind.
In den gleichen Zeitraum fällt die Einführung der indirekt geheizten Röhren,
mit denen erst vernünftige Empfänger für den direkten Anschluß
an das Wechselstromnetz hergestellt werden konnten. Fast alle bis dahin
konstruierten Röhren benötigten zur Heizung ein Gleichspannung von z.B. 4 Volt,
die meist aus Akkumulatoren bezogen wurde!
Perfektionisten
 Nachdem bis in die Endzwanziger viel Pionierarbeit geleistet
worden war, konnte die Elektronenröhre nun immer weiter perfektioniert
werden. Verbundröhren wie z.b. die REN924 (Diode/Triode) oder die RENS1254
(Diode/Tetrode) etablierten sich endgültig und bestimmte Kombinationen,
z.B. Triode/Hexode wie ACH1 (ab 1934), ECH11 (ab 1938) oder ECH81 (ab 1952)
wurden bis zum Ende der Röhrenära immer wieder neu aufgelegt.
Nachdem bis in die Endzwanziger viel Pionierarbeit geleistet
worden war, konnte die Elektronenröhre nun immer weiter perfektioniert
werden. Verbundröhren wie z.b. die REN924 (Diode/Triode) oder die RENS1254
(Diode/Tetrode) etablierten sich endgültig und bestimmte Kombinationen,
z.B. Triode/Hexode wie ACH1 (ab 1934), ECH11 (ab 1938) oder ECH81 (ab 1952)
wurden bis zum Ende der Röhrenära immer wieder neu aufgelegt.
Die Mehrgitterröhren gehörten zum Standard in fast allen Empfängertypen und
1934 wurde in Europa ein neues, einheitliches, in den Grundzügen bis heute
gültiges Typensystem eingeführt.
1936 entwickelten die beiden RCA-Techniker Harry C. Thompson und Herbert M. Wagner das
magische Auge.
Die grün glimmenden Abstimmanzeigeröhren wurden zum Erkennungszeichen
röhrenbetriebener Geräte.
 Die im gleichen Jahr von der RCA vorgestellten Stahlröhren versprachen
jedoch keine Vorteile für den Anwender.
Man wollte sich einfach nur von der Konkurrenz abssetzen, und hatte die Glaskolben durch
solche aus Metall ersetzt.
Die im gleichen Jahr von der RCA vorgestellten Stahlröhren versprachen
jedoch keine Vorteile für den Anwender.
Man wollte sich einfach nur von der Konkurrenz abssetzen, und hatte die Glaskolben durch
solche aus Metall ersetzt.
Erst die 1938 von Telefunken entwickelten
Stahlröhren der harmonischen Serie brachten einen Vorteil im Empfängerbau. Die Systeme
waren nicht mehr vertikal sondern horizontal im Stahlkolben untergebracht. Vorteile
bei der HF-Leitungszuführung waren dafür ausschlaggebend. Als die Systeme später immer
kleiner wurden, verließ man diese Bauart jedoch wieder.
Krieg
 Der 2. Weltkrieg brachte vor allem eine immer größere Miniaturisierung und ein
Vordringen in immer höhere Frequenzbereiche, beschleunigt vor allem durch den Einsatz
des Radars.
Eine Entwicklung, die in Deutschland zuerst verschlafen wurde, weil die militärische Führung
die hier angewandten hohen Frequenzen als unbrauchbar ansah. So waren die ersten deutschen
Höchstfrequenzröhren auch Nachbauten aus abgeschossenen englischen Flugzeugen. Man beherrschte
die zur Produktion notwendigen Verfahren einfach nicht.
Der 2. Weltkrieg brachte vor allem eine immer größere Miniaturisierung und ein
Vordringen in immer höhere Frequenzbereiche, beschleunigt vor allem durch den Einsatz
des Radars.
Eine Entwicklung, die in Deutschland zuerst verschlafen wurde, weil die militärische Führung
die hier angewandten hohen Frequenzen als unbrauchbar ansah. So waren die ersten deutschen
Höchstfrequenzröhren auch Nachbauten aus abgeschossenen englischen Flugzeugen. Man beherrschte
die zur Produktion notwendigen Verfahren einfach nicht.
Charakteristisch an den deutschen
Wehrmachtsröhren, sind ihre von den zivilen Typen vollständig verschiedenen Sockel.
In zig millionenfacher Auflage wurde die bekannteste aller Wehrmachtsröhren hergestellt: Die
Wehrmachtspentode RV12P2000.
Sie ist dann auch in fast allen kurz nach dem Krieg hergestellten Radiogeräten zu finden,
wie z.B. im Funkstrahl Zaunkönig, denn
überall waren Restbestände dieser Universalröhre zu finden.
Durch die allgemeine
Röhrenknappheit wurde sie zu einem gesuchten Tauschpbjekt. Wollte man sie mit dem
wertlosen Geld kaufen, so waren mindestens 100.- RM dafür hinzublättern.
Als die Restbestände zur Neige gingen, begann
Telefunken schon ab Januar 1946 in Berlin wieder mit der beschwerlichen Neuproduktion
auf noch vorhandenen und wieder instandgesetzten Maschinen.
Da zivile Röhren weder für Ersatz- noch Selbstbauzwecke erhältlich waren wurde die RV12P2000
als Ersatz aller möglichen Standardröhren mißbraucht. Umfangreiche
Umbauarbeiten waren die Regel, zweimal RV12P200 anstatt einmal VCL11, oder einmal RV12P200 anstatt EF11.
Die universellen Eigenschaften der P2000 kamen hier voll zum Tragen.
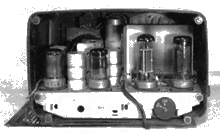 Noch 1939 entwickelte Philips die ersten europäischen Allglasröhren mit Preßglassockel, die Röhren
der 21er Serie. Erstes Gerät mit diesen Röhren war der ab 1941 produzierte Philips Kleinsuper
BD203, wegen seiner Größe Komißbrot genannt. Im freien Handel waren die 21er Röhren
erst ab 1947 von Philips und Lorenz erhältlich. Aufbauend auf diesen Typen stellte
Philips/Valvo außerdem während dem Krieg die Röhren der 25er Serie her, die ihren Einsatz in
diversen Wehrmachtsgeräten, so z.B. den Wehrmachtsradios hatten.
Noch 1939 entwickelte Philips die ersten europäischen Allglasröhren mit Preßglassockel, die Röhren
der 21er Serie. Erstes Gerät mit diesen Röhren war der ab 1941 produzierte Philips Kleinsuper
BD203, wegen seiner Größe Komißbrot genannt. Im freien Handel waren die 21er Röhren
erst ab 1947 von Philips und Lorenz erhältlich. Aufbauend auf diesen Typen stellte
Philips/Valvo außerdem während dem Krieg die Röhren der 25er Serie her, die ihren Einsatz in
diversen Wehrmachtsgeräten, so z.B. den Wehrmachtsradios hatten.
Auferstanden aus Ruinen
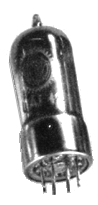 Nach dem verlorenen Krieg war an eine Wiederaufnahme der Röhrenproduktion zuerst einmal
nicht zu denken. Rohstoffe waren nicht zu bekommen, die Industrieanlagen zumeist ausgebombt und
die Restriktionen der Besatzungsmächte unterbunden das öffentliche Leben fast gänzlich.
Nach dem verlorenen Krieg war an eine Wiederaufnahme der Röhrenproduktion zuerst einmal
nicht zu denken. Rohstoffe waren nicht zu bekommen, die Industrieanlagen zumeist ausgebombt und
die Restriktionen der Besatzungsmächte unterbunden das öffentliche Leben fast gänzlich.
Anders sah es hier in Holland aus. Philips in Eindhoven konnte schon 1947 die neuen,
miniaturisierten Rimlockröhren vorstellen. Philips/Valvo in Deutschland kämpfte zur
gleichen Zeit mit dreimonatigen Produktionsausfällen wegen eines ungewöhnlich kalten Winters - Die
Produktionshallen in Hamburg konnten mangels Kohle nicht geheizt werden. Rimlockröhren
wurden hierzulande erst ab 1949 ausgeliefert.
Telefunken begann 1946 wieder mit der Auslieferung neuer Röhren. Die
Stahlröhren wurden auf vertikalen Systemaufbau und Glaskolben abgeändert, um
fabrikatsionsbedingte Schwierigkeiten zu umgehen. Trotzdem konnten die technischen Daten
eingehalten werden.
Revolution!
Am 23. Dezember 1947 endeckten die
Amerika John Bardeen, Walter House Brattain und William Shockley in den
Bell Laboratories / New York den ersten Transistor.
Niemand konnte damals die Auswirkungen dieser Entdeckung auch nur erahnen. Weil die
Bell Laboratories die Patente gegen Zahlung von Lizenzgebühren á 25000$
freigeben mußten, konnten von Anfang an viele Produzenten an der
weiteren Nutzbarmachung des Transistors teilnehmen. Aber das ist eine andere
Geschichte.
Quellenangaben:
1) Erb, Ernst - Radios von Gestern, M + K Computer Verlag AG, Luzern - Schweiz 1989
2) Abele, Günter F. - Historische Radios in Wort und Bild (Band 1 ), Füsslin Verlag, Stuttgart 1996
3) Salzmann, Gerhad B. - Zur Geschichte der RV12P2000 / Band 4 - Schriftenreihe zur Funkgeschichte, Verlag Dr. Rüdiger Walz, Kelkheim 1994
4) Martin Steyer, DK7ZB - Zur Erfindung der Verstärkerröhre, CQ DL 4/96, Seite 316
5) Ludwig Ratheiser, Rundfunk - Röhren, Regelien´s Verlag, Berlin, Hannover, 1949
5) Herbert G. Mende, Radio - Röhren, RPB 18/19, Franzis Verlag München, 1966
© 1998-2000 Dirk Becker
 Der Österreicher Robert von Lieben und der Amerikaner Lee de Forrest entlockten ihr ein Jahr
später unabhängig voneinander eine Verstärkerwirkung. Lee der Forrest endeckte später (1912) auch noch
den über Jahre äußerst bedeutsamen Audioneffekt, weil mit ihm gleichzeitig
demoduliert (gleichgerichtet) und verstärkt werden kann.
Der Österreicher Robert von Lieben und der Amerikaner Lee de Forrest entlockten ihr ein Jahr
später unabhängig voneinander eine Verstärkerwirkung. Lee der Forrest endeckte später (1912) auch noch
den über Jahre äußerst bedeutsamen Audioneffekt, weil mit ihm gleichzeitig
demoduliert (gleichgerichtet) und verstärkt werden kann.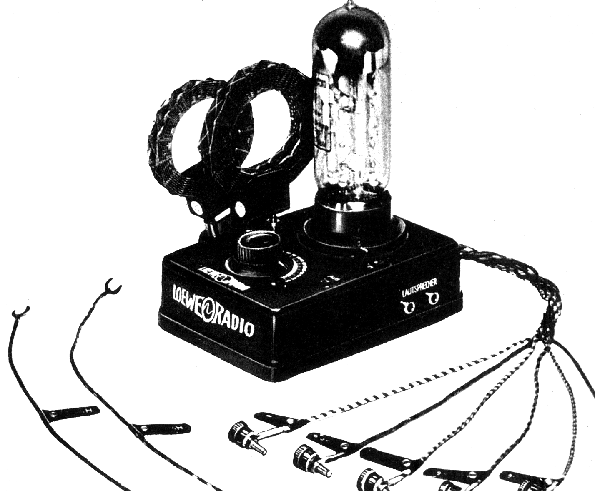 Der Berliner Radiopionier Dr. Sigmund Loewe ging sogar soweit, einen kompletten
Verstärker inklusive aller Koppelelemente unter einen großen
Kolben zu setzen.
Der erste integrierte Schaltkreis war geboren!
Der Berliner Radiopionier Dr. Sigmund Loewe ging sogar soweit, einen kompletten
Verstärker inklusive aller Koppelelemente unter einen großen
Kolben zu setzen.
Der erste integrierte Schaltkreis war geboren! Nachdem bis in die Endzwanziger viel Pionierarbeit geleistet
worden war, konnte die Elektronenröhre nun immer weiter perfektioniert
werden. Verbundröhren wie z.b. die REN924 (Diode/Triode) oder die RENS1254
(Diode/Tetrode) etablierten sich endgültig und bestimmte Kombinationen,
z.B. Triode/Hexode wie ACH1 (ab 1934), ECH11 (ab 1938) oder ECH81 (ab 1952)
wurden bis zum Ende der Röhrenära immer wieder neu aufgelegt.
Nachdem bis in die Endzwanziger viel Pionierarbeit geleistet
worden war, konnte die Elektronenröhre nun immer weiter perfektioniert
werden. Verbundröhren wie z.b. die REN924 (Diode/Triode) oder die RENS1254
(Diode/Tetrode) etablierten sich endgültig und bestimmte Kombinationen,
z.B. Triode/Hexode wie ACH1 (ab 1934), ECH11 (ab 1938) oder ECH81 (ab 1952)
wurden bis zum Ende der Röhrenära immer wieder neu aufgelegt.
 Die im gleichen Jahr von der RCA vorgestellten Stahlröhren versprachen
jedoch keine Vorteile für den Anwender.
Man wollte sich einfach nur von der Konkurrenz abssetzen, und hatte die Glaskolben durch
solche aus Metall ersetzt.
Die im gleichen Jahr von der RCA vorgestellten Stahlröhren versprachen
jedoch keine Vorteile für den Anwender.
Man wollte sich einfach nur von der Konkurrenz abssetzen, und hatte die Glaskolben durch
solche aus Metall ersetzt. Der 2. Weltkrieg brachte vor allem eine immer größere Miniaturisierung und ein
Vordringen in immer höhere Frequenzbereiche, beschleunigt vor allem durch den Einsatz
des Radars.
Eine Entwicklung, die in Deutschland zuerst verschlafen wurde, weil die militärische Führung
die hier angewandten hohen Frequenzen als unbrauchbar ansah. So waren die ersten deutschen
Höchstfrequenzröhren auch Nachbauten aus abgeschossenen englischen Flugzeugen. Man beherrschte
die zur Produktion notwendigen Verfahren einfach nicht.
Der 2. Weltkrieg brachte vor allem eine immer größere Miniaturisierung und ein
Vordringen in immer höhere Frequenzbereiche, beschleunigt vor allem durch den Einsatz
des Radars.
Eine Entwicklung, die in Deutschland zuerst verschlafen wurde, weil die militärische Führung
die hier angewandten hohen Frequenzen als unbrauchbar ansah. So waren die ersten deutschen
Höchstfrequenzröhren auch Nachbauten aus abgeschossenen englischen Flugzeugen. Man beherrschte
die zur Produktion notwendigen Verfahren einfach nicht. 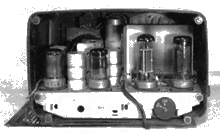 Noch 1939 entwickelte Philips die ersten europäischen Allglasröhren mit Preßglassockel, die Röhren
der 21er Serie. Erstes Gerät mit diesen Röhren war der ab 1941 produzierte Philips Kleinsuper
BD203, wegen seiner Größe Komißbrot genannt. Im freien Handel waren die 21er Röhren
erst ab 1947 von Philips und Lorenz erhältlich. Aufbauend auf diesen Typen stellte
Philips/Valvo außerdem während dem Krieg die Röhren der 25er Serie her, die ihren Einsatz in
diversen Wehrmachtsgeräten, so z.B. den Wehrmachtsradios hatten.
Noch 1939 entwickelte Philips die ersten europäischen Allglasröhren mit Preßglassockel, die Röhren
der 21er Serie. Erstes Gerät mit diesen Röhren war der ab 1941 produzierte Philips Kleinsuper
BD203, wegen seiner Größe Komißbrot genannt. Im freien Handel waren die 21er Röhren
erst ab 1947 von Philips und Lorenz erhältlich. Aufbauend auf diesen Typen stellte
Philips/Valvo außerdem während dem Krieg die Röhren der 25er Serie her, die ihren Einsatz in
diversen Wehrmachtsgeräten, so z.B. den Wehrmachtsradios hatten.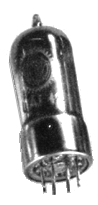 Nach dem verlorenen Krieg war an eine Wiederaufnahme der Röhrenproduktion zuerst einmal
nicht zu denken. Rohstoffe waren nicht zu bekommen, die Industrieanlagen zumeist ausgebombt und
die Restriktionen der Besatzungsmächte unterbunden das öffentliche Leben fast gänzlich.
Nach dem verlorenen Krieg war an eine Wiederaufnahme der Röhrenproduktion zuerst einmal
nicht zu denken. Rohstoffe waren nicht zu bekommen, die Industrieanlagen zumeist ausgebombt und
die Restriktionen der Besatzungsmächte unterbunden das öffentliche Leben fast gänzlich.